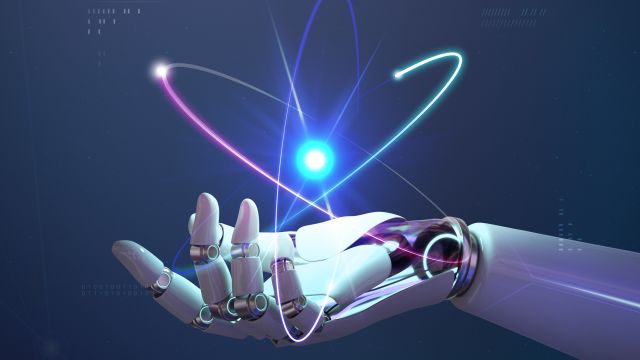
Künstliche Intelligenz in der Kerntechnik – zwischen Potenzial und Verantwortung
Weltweit lassen sich unterschiedliche Ansätze für KI-Anwendungen ausmachen, die in teilweise ganz unterschiedlichen Entwicklungsstadien stecken. Um die Potenziale und Grenzen von KI in der Kerntechnik differenziert zu betrachten, bietet sich eine Einteilung der Anwendungsgebiete in verschiedene Kategorien an (s. nachstehendes Ausklappmenü). Im Folgenden soll dieser Beitrag anhand konkreter Beispiele einen Überblick über den aktuellen Stand von KI-Anwendungen in der Praxis und entsprechende Aktivitäten auf Seiten von Behörden bzw. Regulatoren bieten.
Im Bereich Engineering und Design ermöglicht KI die modellbasierte Entwicklung und Simulation komplexer kerntechnischer Systeme. Hier dienen sogenannte „digitale Zwillinge“ als virtuelle Repräsentationen einzelner Komponenten oder Teilsysteme, etwa des Reaktorkerns oder Kühlkreislaufs, und erlauben die Analyse von Betriebsverhalten bereits in der Planungsphase. KI-gestützte Verfahren kommen auch bei der Optimierung von Reaktorkomponenten und der Auslegung von Brennstoffarchitekturen zum Einsatz. Durch die Kombination physikalischer Modelle mit datengetriebenen Ansätzen lassen sich Designentscheidungen fundierter treffen und technische Innovationen beschleunigen.
Im Bereich der Diagnose kann Künstliche Intelligenz die frühzeitige Erkennung von Fehlern und Materialschäden in kerntechnischen Anlagen unterstützen. Durch die Analyse umfangreicher Sensordaten, etwa aus Schwingungs-, Temperatur- oder Strahlungsmessung, lassen sich Anomalien identifizieren, die auf Korrosion, Rissbildung oder andere strukturelle Veränderungen hinweisen. KI-Modelle erkennen dabei Muster und Abweichungen, die mit herkömmlichen Analyseverfahren nur schwer erfassbar wären, und ermöglichen eine kontinuierliche Zustandsüberwachung sicherheitsrelevanter Komponenten wie Rohrleitungen, Pumpen oder Messumformer.
KI-gestützte Prognoseverfahren können der Vorhersage von Betriebszuständen und von technischen Entwicklungen innerhalb kerntechnischer Systeme dienen. Sie sollen etwa bei der Modellierung und Prognose von Temperaturverläufen, Druckentwicklungen oder dem Verschleißverhalten von Materialien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus können sie zur Lastprognose im Stromnetz beitragen, insbesondere im Zusammenspiel mit anderen Energiequellen.
In kritischen Situationen wie Störfällen oder Notfällen soll KI zur Echtzeitanalyse und Entscheidungsunterstützung beitragen. Durch die schnelle Auswertung verfügbarer Daten sollen sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen, die wiederum das Notfallmanagement verbessern. Digitale Zwillinge bilden dabei den aktuellen Zustand eines realen Systems ab. Sie können somit in Simulationen eingebunden oder als Simulationsumgebung genutzt werden, um hypothetische Ereignisse und Reaktionsstrategien zu analysieren. Auch im Bereich der Cybersecurity spielt KI eine zunehmend wichtige Rolle, etwa bei der Erkennung und Abwehr von Angriffen auf digitale Infrastrukturen kerntechnischer Anlagen.
KI kann zur Optimierung von Betriebsabläufen und zur Steigerung der Effizienz in kerntechnischen Anlagen beitragen. KI-gestützte Optimierungsassistenzsysteme kommen bereits heute zur Unterstützung von Steuerungsprozessen zum Einsatz, etwa der Regelung von Kühlmittelströmen oder der Brennstoffnutzung. Durch lernende Systeme lassen sich Abläufe verbessern und an wechselnde Bedingungen anpassen. Dies soll nicht nur die Wirtschaftlichkeit erhöhen, sondern auch die Betriebssicherheit stärken, indem menschliche Fehler reduziert und technische Ressourcen gezielter eingesetzt werden.
KI-Anwendungen in der Technologie-Entwicklung
Unterschiedliche Anwendungen der künstlichen Intelligenz werden weltweit bei Entwicklungsprojekten eingesetzt. Sogenannte „Grey-Box Digital Twins“ beispielsweise sind hybride Modelle, die physikalische und datengetriebene Ansätze kombinieren, um kerntechnische Systeme realitätsnah abzubilden. In der Entwicklung von Reaktoranlagen sollen sie eine präzise Simulation des Anlagenverhaltens unter verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglichen. KI-gestützte Komponenten innerhalb dieser Zwillinge dienen der Fehlerkorrektur, der Echtzeitprognose und der Risikoanalyse. Durch die Integration von Echtzeitdaten können Designentscheidungen validiert und sicherheitsrelevante Aspekte bereits in frühen Entwicklungsphasen berücksichtigt werden.
Generell lässt sich sagen, dass maschinelles Lernen zunehmend zur Simulation komplexer physikalischer Prozesse in der Reaktorentwicklung eingesetzt wird. Neuronale Netze, insbesondere tiefe Architekturen („Deep Neural Networks“), können beispielsweise thermodynamische Abläufe, Strömungsverhalten und Materialreaktionen mit hoher Genauigkeit abbilden. Diese Simulationsmodelle sollen es ermöglichen, verschiedene Designvarianten zu vergleichen und die Auswirkungen technischer Parameter auf die Sicherheit und Leistungsfähigkeit eines Reaktors zu bewerten.
Ein Beispiel ist der Xe-100 des US-amerikanischen Unternehmens X-energy; dabei handelt es sich um ein Konzept für einen gasgekühlten Hochtemperaturreaktor mit modularer Bauweise. Im Entwicklungsprozess dieses Reaktors kommt KI in mehreren Bereichen zum Einsatz: So unterstützen KI-Modelle die Optimierung des Reaktordesigns hinsichtlich passiver Sicherheit, Transportfähigkeit und Montagetempo. Darüber hinaus wird KI zur Simulation thermischer Prozesse und zur Analyse des Materialverhaltens genutzt, wodurch laut Herstellerangaben physische Prototypen reduziert und Designentscheidungen fundierter getroffen werden sollen. Auch bei der Herstellung des benötigten TRISO-X-Brennstoffs, der für hohe Temperaturen ausgelegt ist, wird KI zur Qualitätskontrolle und Prozesssteuerung eingesetzt.
Der Aurora SMR von Oklo Inc. ist ein kompaktes Reaktordesign, das seinen Entwicklern zufolge auf die Wiederverwertung nuklearer Brennstoffe und eine flexible Standortwahl ausgelegt ist. Im Entwicklungsprozess dieses Reaktors wird KI eingesetzt, um die Kopplung von Brennstoffherstellung und Reaktordesign zu optimieren. Darüber hinaus setzt der Entwickler auf KI-gestützte Modelle, um Standortdaten zu analysieren und regulatorische Anforderungen frühzeitig zu berücksichtigen. Ziel ist es, Genehmigungsprozesse zu beschleunigen und die technische Auslegung des Reaktors an unterschiedliche Rahmenbedingungen anzupassen.
KI-Anwendungen im Reaktorbetrieb
Im laufenden Betrieb können KI-Systeme zur Zustandsüberwachung und Fehlererkennung beitragen. So können beispielsweise „Condition-Monitoring-Systeme“ Sensordaten analysieren, um etwa Korrosion, Materialermüdung oder Leckagen frühzeitig zu erkennen. Studien zeigen, dass neuronale Netze in der Lage sind, Schädigungsgrade zu klassifizieren und Wartungsmaßnahmen gezielt vorzuschlagen.
Ein Beispiel ist das AIMD-System von KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power), das auf Basis von Big Data und KI die Zustände von über 12.000 Komponenten in 26 Reaktoren überwacht. Es kombiniert regelbasierte Diagnostik, Frequenzanalyse und maschinelles Lernen, um Anomalien frühzeitig zu erkennen und Wartungsmaßnahmen zu empfehlen. Die Ergebnisse werden in 3D-Modellen visualisiert, was die Entscheidungsfindung unterstützen soll.
Auch Large Language Models (LLMs) finden zunehmend Anwendung in der Kerntechnik. Dabei handelt es sich um KI-Systeme, die auf umfangreichen Textdaten trainiert wurden und in der Lage sind, Sprache zu verstehen und zu erzeugen. In technischen Anwendungen können sie genutzt werden, um komplexe Informationen zu strukturieren, Fragen zu beantworten oder Entscheidungen zu unterstützen – etwa durch die Interaktion mit Bedienpersonal.
Das Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) entwickelt mit Atomic GPT ein KI-basiertes Assistenzsystem zur Unterstützung des Reaktorbetriebs. Im Zentrum steht ein Agentensystem, das auf einem LLM basiert und Bedienpersonal in einem Reaktorsimulator bei der Durchführung komplexer Aufgaben unterstützt. Ziel ist es, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine im Kontrollraum zu verbessern und die Entscheidungsfindung durch kontextbezogene Vorschläge zu erleichtern. Das System wird im Rahmen der Entwicklung fortschrittlicher Reaktorkonzepte erprobt und soll langfristig zur Qualitätssicherung in der Anlagenführung beitragen.
Das US-amerikanische Unternehmen Nuclearn.ai entwickelt eine spezialisierte KI-Plattform, die auf die Anforderungen kerntechnischer Anlagen zugeschnitten ist. Ziel ist es, komplexe technische und regulatorische Prozesse durch KI zu unterstützen. Die Plattform soll unter anderem bei der Erstellung und Auswertung von Zustandsberichten, der Trendanalyse, der Sicherheitsdokumentation und der regulatorischen Kommunikation zum Einsatz kommen. Nach Herstellerangaben ist die Lösung für den Einsatz in hochsicheren Umgebungen konzipiert und erfüllt regulatorische Standards und Exportkontrollvorgaben.
Das russische Unternehmen RASU JSC hat ein KI-basiertes Assistenzsystem entwickelt, das große Mengen technischer Daten auswerten und ebenfalls zur Entscheidungsfindung im Kontrollraum beitragen soll. Ziel ist es, die Betriebssicherheit durch frühzeitige Erkennung von Abweichungen zu erhöhen. KI-Modelle kommen unter anderem bei der Analyse von Prozessdaten, der Visualisierung komplexer Zusammenhänge und der Ableitung von Handlungsempfehlungen zum Einsatz. Mitte 2025 wurde das System in Block 6 des russischen Kernkraftwerks Nowoworonesch integriert.
Neben der Unterstützung des laufenden Betriebs spielt KI auch eine zunehmend wichtige Rolle in der Wartung und Instandhaltung kerntechnischer Anlagen. Durch die automatisierte Auswertung von Prüf- und Sensordaten sollen unter anderem Inspektionsprozesse effizienter gestaltet und sicherheitsrelevante Veränderungen frühzeitig erkannt werden. Das französische Unternehmen Framatome hat unter anderem KI-gestützte Verfahren für zerstörungsfreie Prüfungen entwickelt. Diese kommen etwa bei der Inspektion von Reaktordruckbehältern zum Einsatz und kombinieren automatisierte Ultraschall-, Wirbelstrom- und visuelle Prüfverfahren. Ziel ist eine präzise Erkennung von Materialveränderungen bei gleichzeitig reduzierter Strahlenbelastung für das Personal.
Auch die China National Nuclear Power (CNNP) setzt KI gezielt zur Unterstützung von Wartung und Betriebsführung ein. Mit der Plattform I-Nuclear wurde ein digitales Servicekonzept entwickelt, das KI-gestützte Werkzeuge für die Inbetriebnahme, die technische Analyse und die Instandhaltung kerntechnischer Anlagen bereitstellt. Die Plattform soll dazu beitragen, sicherheitsrelevante Prozesse effizienter zu gestalten, die Qualität technischer Bewertungen zu verbessern und das Betriebspersonal durch digitale Assistenzsysteme zu unterstützen. Durch die modulare Struktur lassen sich verschiedene Reaktortypen flexibel abbilden.
Ein konkretes Beispiel für KI-basierte Prognose ist die Vorhersage von sogenanntem Moisture Carryover (MCO) in Siedewasserreaktoren. MCO kann zu Korrosion an Turbinenblättern und erhöhten Strahlenbelastungen durch Cobalt-60 führen. Der US-amerikanische Softwareentwickler Blue Wave AI Labs hat ein KI-Modell entwickelt, das historische Betriebsdaten nutzt, um MCO-Werte vorab zu prognostizieren. Dies soll gezielte Maßnahmen zur Schadensvermeidung und zur Reduktion von Personendosen ermöglichen.
Hervorzuheben sind noch die Entwicklungsarbeiten von Westinghouse: Das US-amerikanische Unternehmen hat mit dem HiVE-System und dem LLM bertha eine nuklearspezifische KI-Plattform entwickelt, die den gesamten Lebenszyklus von Reaktoren unterstützen soll – von Design und Lizenzierung über Fertigung und Bau bis hin zum Betrieb. In Zusammenarbeit mit Google Cloud wurde ein Proof-of-Concept realisiert, bei dem modulare Baupakete für AP1000-Reaktoren automatisch generiert und optimiert wurden. Die Plattform nutzt Technologien wie Vertex AI, Gemini und BigQuery, wodurch Designprozesse beschleunigt und die Betriebsführung bestehender Anlagen datenbasiert verbessert werden sollen. Neben der technischen Entwicklung soll das System auch Wartungsplanung, Inspektionsprozesse und die digitale Nutzerführung in kerntechnischen Einrichtungen unterstützen.
KI und Sicherheit
Mit dem zunehmenden Einsatz von KI in der kerntechnischen Praxis rücken auch Fragen der Sicherheit, der Genehmigung und der regulatorischen Bewertung stärker in den Fokus, weil KI-Systeme tief in technische Abläufe eingreifen und sicherheitsrelevante Entscheidungen beeinflussen können. Das stellt nicht nur die Aufsichtsbehörden vor neue Herausforderungen, sondern wirft auch Fragen für die Sicherheitsforschung und die Begutachtung technischer Konzepte auf. Im Folgenden werden Ansätze vorgestellt, wie regulatorische Institutionen und internationale Gremien mit diesen Entwicklungen umgehen.
So hat beispielsweise die US-amerikanische Nuclear Regulatory Commission (USNRC) eine umfassende KI-Strategie für die Jahre 2023–2027 veröffentlicht. Diese Strategie verfolgt fünf zentrale Ziele:
- regulatorische Entscheidungsfähigkeit sicherstellen
- eine organisatorische Struktur zur Bewertung von KI-Anwendungen etablieren
- Partnerschaften im KI-Bereich ausbauen
- eine KI-kompetente Belegschaft fördern
- Anwendungsfälle verfolgen, um eine KI-Fundament in der NRC aufzubauen.
Darüber hinaus hat die USNRC gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden aus Kanada und dem Vereinigten Königreich ein Papier veröffentlicht, in dem grundlegende Anforderungen an den sicheren Einsatz von KI in der Kerntechnik formuliert werden – etwa Transparenz, Robustheit, ethische Verantwortung und die Berücksichtigung menschlicher und organisatorischer Faktoren. Diese Prinzipien sollen als Orientierung für Entwickler, Betreiber und Regulierer dienen und die internationale Harmonisierung regulatorischer Standards fördern.
Ein Beispiel für die Vorbereitung auf den Einsatz disruptiver Technologien auf internationaler Ebene ist das RegLab Project der OECD Nuclear Energy Agency. Ziel der Initiative ist es, neue Technologien wie KI, Robotik oder 3D-Druck unter realitätsnahen, aber kontrollierten Bedingungen zu erproben. Im Zentrum stehen sogenannte „Sandboxing“-Runden – strukturierte Testphasen, in denen neue Ansätze simuliert und bewertet werden, ohne dass sie bereits in genehmigten oder produktiven Umgebungen eingesetzt werden müssen. So lassen sich sicherheitstechnische Aspekte, regulatorische Anforderungen und praktische Einsatzmöglichkeiten systematisch analysieren. Die Erkenntnisse sollen dazu dienen, bestehende Regelwerke weiterzuentwickeln und Empfehlungen für nationale und internationale Gremien abzuleiten.
Auch die Netzintegration kerntechnischer Anlagen wirft neue regulatorische Fragen auf – insbesondere, wenn KI zur automatisierten Leistungsregelung eingesetzt wird. Systeme, die technische Parameter in Echtzeit bewerten und Steuerimpulse ableiten, müssen nicht nur funktional zuverlässig sein, sondern auch sicherheitsseitig nachvollziehbar und genehmigungsfähig. Die chinesische Energiebehörde NEA beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit der technischen Bewertung solcher Systeme und deren Rolle im Zusammenspiel zwischen Reaktorbetrieb und Netzstabilität.
KI in der GRS – Forschung und Anwendung
Die GRS beschäftigt sich intensiv mit der Bewertung und Qualifikation von KI-Systemen für sicherheitskritische Anwendungen. Im Rahmen eines durch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung geförderten Projekts wurde beispielsweise ein modulares Bewertungsschema entwickelt, das die besonderen Eigenschaften von KI berücksichtigt – etwa die Tatsache, dass viele KI-Systeme nicht deterministisch arbeiten. Das bedeutet: Sie liefern nicht immer exakt dieselbe Entscheidung oder Empfehlung, selbst wenn die Eingabedaten gleich sind. Diese Eigenschaft unterscheidet KI grundlegend von klassischer Software und stellt besondere Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Testbarkeit und Sicherheit. Ziel es, die Übertragbarkeit klassischer Anforderungen aus der Softwareentwicklung – etwa Modularität, Testbarkeit und Robustheit – auf KI-Systeme zu prüfen und weiterzuentwickeln.
Darüber hinaus analysiert die GRS, wie bestehende Regelwerke (beispielsweise KTA 3501) auf KI-Anwendungen angewendet werden können und wo Anpassungsbedarf besteht. Die Ergebnisse fließen in die Weiterentwicklung von Bewertungsmaßstäben und in die Beratung von Behörden und Ministerien ein.
Neben der Bewertung externer KI-Systeme setzt die GRS Künstliche Intelligenz auch selbst in Forschungsprojekten ein. Ziel ist es, die Möglichkeiten datengetriebener Verfahren für sicherheitsrelevante Fragestellungen auszuloten und praktische Anwendungen zu entwickeln. Ein Beispiel ist ein vom Bundesforschungsministerium gefördertes Forschungsprojekt zur Unterstützung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen. Hier entwickelt die GRS gemeinsam mit Partnern eine hybride Lernplattform mit VR- und AR-Elementen sowie ein KI-basiertes System für rückbauspezifisches Wissensmanagement. Ziel ist es, Fachkräfte effizienter zu qualifizieren und Genehmigungsprozesse transparenter zu gestalten.
Gefördert durch das Bundesumweltministerium untersuchte die GRS den Einsatz künstlicher neuronaler Netze zur Erstellung sogenannter kritischer Parameterkurven, die in der nuklearen Sicherheitsforschung eine zentrale Rolle spielen. Diese Kurven abzuleiten, ist bislang rechenintensiv. Die Studie zeigte, dass neuronale Netze reale Daten über weite Bereiche hinweg gut reproduzieren können – insbesondere in stark nichtlinearen Randbereichen, wo sie klassische Interpolationsverfahren deutlich übertrafen.
In einem Forschungsvorhaben im Auftrag der Schweizer Aufsichtsbehörde ENSI entwickeln Kolleginnen und Kollegen die sogenannte „Adaptive Monte-Carlo-Simulationsmethodik“ weiter, um kritische Parameterbereiche bei Kühlmittelverluststörfällen in Siedewasserreaktoren zu identifizieren. Zum Einsatz kommen Verfahren des maschinellen Lernens, die es ermöglichen, komplexe Zusammenhänge zwischen Eingangsparametern und sicherheitsrelevanten Ergebnissen effizient zu analysieren.
Ein weiteres Beispiel stellen schließlich Arbeiten der GRS gemeinsam mit Partnerinstitutionen an der Entwicklung von Verfahren zur Restlebensdauerbewertung metallischer Komponenten in Kernkraftwerken dar. Ziel ist es, Alterungsprozesse unter realistischen Betriebsbedingungen – etwa durch thermische Wechsellasten im Lastfolgebetrieb – besser zu erfassen und zu bewerten. Dabei kommen auch Techniken des maschinellen Lernens, insbesondere neuronale Netze, zum Einsatz, um Muster in Messdaten zerstörungsfreier Prüfverfahren zu erkennen und die Ermüdungsschädigung vorherzusagen. Die KI dient hier als Werkzeug zur datenbasierten Analyse mit dem Ziel, den Alterungsprozess überwachen zu können und Schäden bereits in einem frühen Stadium zu erkennen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Künstliche Intelligenz bietet der Kerntechnik neue Möglichkeiten – etwa zur Optimierung technischer Prozesse, zur Unterstützung im Betrieb oder zur Automatisierung von Dokumentationsaufgaben. Gleichzeitig stellt sie neue Anforderungen an Sicherheit und regulatorische Einbettung. Die GRS verfolgt das Ziel, diese Entwicklungen kritisch zu begleiten, ihre Potenziale realistisch zu bewerten und ihre Risiken systematisch zu analysieren. Denn klar ist: Der Einsatz von KI in der Kerntechnik muss nachvollziehbar, robust und regelkonform erfolgen, sodass die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird.